 Blog
Blog
 Blog
Blog
 Blog
Blog
Wetter
Es ist in aller Munde – nicht nur im Modus tagtäglichen Vergewisserns der lokalen Wetterlagen, sondern zunehmend auch unter dem Vorzeichen eines aus den Fugen geratenen, globalen ökologischen Gleichgewichts: das Wetter. Die Auseinandersetzung mit dem elementaren, gleichwohl weltumspannenden Phänomen, dem die Menschheit nach wie vor ausgesetzt ist, bewegt sich situations- und interessenabhängig zwischen privater Betroffenheit, ästhetischer Anmutung und wissenschaftlicher Einordnung.
Read more »call for papers:« →
 Blog
Blog
Tagungsbericht
„Improvisation in der Musik ist wie vor einer weißen Leinwand stehen und ein Bild malen, sie kommt ganz tief aus einem selbst. […] Improvisation ist Kommunikation. Mit anderen und mit sich selbst.“ (Gebhard Ullmann, Berlin) „Improvisation bedeutet den Mut, Unvorhergesehenem zu begegnen, und die Bereitschaft, gleichermaßen, erfolgreich zu sein oder zu scheitern.“ (Tilo Augsten, Leipzig)
 Blog
Blog
Eine Rezension von:
Unger-Rudroff, Anna: Bewegung und Musikverstehen. Leibphänomenologische Perspektiven auf die musikalische Begriffsbildung bei Kindern. Bielefeld 2020.
An den seit einigen Jahren erfreulicherweise wieder Fahrt aufnehmenden Leib-Diskurs der Musikpädagogik (vgl. u. a. Oberhaus 2006, Oberhaus & Stange 2017) knüpft die hier vorgestellte Dissertationsschrift von Anna Unger-Rudroff an.[1] Sie vertieft und bereichert die bisherige Diskussion durch einen detailliert (leib)phänomenologischen Blick auf das Wechselverhältnis von körperlich-leiblicher Bewegung und musikbezogenen Verstehensvorgängen. Damit gelingt der Verfasserin nicht nur die bis dato umfassendste Behandlung des Themas Bewegung und Musikverstehen, sondern auch eine eindrucksvolle Verteidigung der Notwendigkeit eines leiblich fundierten Musiklernens, wie es schon von unter anderem Wolfgang Rüdiger eingefordert wurde (vgl. 2018).
 Blog
Blog
Nacht
Der Schlaf der Vernunft gebiert seit Goya Ungeheuer, doch das spanische Wort sueño kann auch Traum bedeuten. Wenn die Vernunft schläft, so erheben sich die Ungeheuer; träumt die Vernunft, dann bringt sie vielleicht selbst diese Ungeheuer hervor – und wie ist es rund 220 Jahre später um die Vernunft bestellt? Vom Verstand abgegrenzt, der durch Beobachtung und Erfahrung Sachverhalte erfasst, gilt sie als die geistige Fähigkeit des Menschen, Einsicht und Erkenntnis zu gewinnen, sich ein Urteil zu bilden, die Zusammenhänge und die Ordnung des Wahrgenommenen zu erkennen und sich in seinem Handeln danach zu richten. Schläft sie oder träumt sie nun?
Im Schlaf, so wissen wir inzwischen, werden Wahrnehmungen (dazu gehören auch Gedanken) verarbeitet und neu geordnet; das hat Folgen. Neuere Forschungen zum Traum sehen in ihm somit nicht nur die Verarbeitung der Vergangenheit, sondern auch eine Vorbereitung der Zukunft. Im Traum greifen wir, auch wenn es um Neues geht, auf einen Bildfundus zurück, der überwiegend, aber nicht ausschließlich in den ersten 27 Lebensjahren generiert wurde, denn ungefähr so lange brauchen wir, um dem zum (Über)Leben Wichtige ein erstes Mal begegnet zu sein. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie viel Schlaf und Traum mit Lernvorgängen zu tun haben, auch wenn die Pädagogik nur eines der Felder ist, die mit der Bitte um Textbeiträge angesprochen sind: Kunst, Literatur und Musik, Kunst- Literatur- Musik- Kultur- und Bildungswissenschaften.
Und Nacht ist nicht gleich Schlaf. Schlaf nicht zu viel, so verabschieden sich einige Sprachgruppen letzter Naturvölker am Abend voneinander, es könnten Schlangen und wilde Tiere kommen, und Metropolen wie New York und Tokio nennen sich selbst Städte, die nie schlafen, vor allem nicht nachts. Gibt es noch Nacht und was gibt sie uns? Wie sieht sie aus, wie hört sie sich an, wie riecht und fühlt sie sie an? Was passiert, wenn der dominierende Sehsinn zurücktreten muss, wie lässt sich das Dunkel beleuchten? Wie gehen Kunst, Musik und Literatur damit um? Und wie gehen Lehrende mit jener Zeitspanne um, auf die sie keinen Zugriff haben?
 Blog
Blog
Rezension
„Ich wünsche, ich wäre ein Buchstabe./ Times New Roman und winzig klein./ Dann würde ich, wie es sich gehört in Büchern leben/ Drachen fangen, Mörder jagen, die große Liebe finden./ Ich wünschte, ich wäre ein Buchstabe. /Times New Roman und riesengroß.“ (Göhner, 145)
Der Rezension zum dem von Melanie Babenhauserheide und Anna Bella Eschengerd herausgegebenen Buch, stelle ich einen Text von einer Autorin und ehemaligen Teilnehmerin des Rumpelstilzchen-Literaturprojekts, Stefanie Göhner, voran. Denn einerseits bringt dieser Text die Bedeutsamkeit von Worten und die Wirkmächtigkeit des kreativen Schreibens zum Ausdruck. Andererseits verdeutlicht er, indem die Autorin die Buchstaben zu Textanfang als winzig klein und am Textende als riesengroß beschreibt, welch Entwicklungsmöglichkeiten und Potentiale die Schreiberfahrung im Literaturprojekt für die Teilnehmer*innen barg. Sie erhielten im schulischen Kontext die Chance, ihre eigenen Perspektiven zu finden und zu formulieren, Erfahrungen in Form von Gedichten, Kurzgeschichten zu veröffentlichen und einem Publikum zugänglich zu machen. Damit bringt der Text als Einstieg die Kernidee des Buches auf den Punkt, nämlich das zur Geltung zu bringen und sichtbar zu machen, was sonst herausfällt. (vgl. Babenhauserheide, 69)
 Blog
Blog
Petra Kathke (Hg.): Vom Schatten aus …
Denk- und Handlungsräume in Kunst und Kunstpädagogik
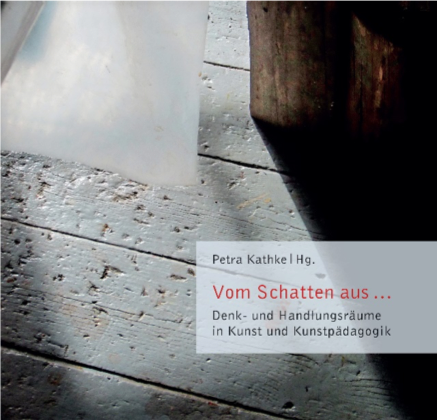
Die in diesem Buch versammelten Beiträge kreisen um Fragen, An- und Einsichten, die das allgegenwärtige Phänomen des Schattens aus kunstwissenschaftlicher, künstlerischer und kunstpädagogischer Perspektive hervorzurufen vermag. Mitarbeiter*innen des Faches Kunst- und Musikpädagogik sowie ehemalige Studierende haben ihre Erfahrungen und Erkenntnisse ebenso beigetragen, wie Kolleg*innen der Herausgeberin.
380 Seiten mit zahlreichen Abbildungen / HardCover mit Fadenheftung / fabrico Verlag Hannover 2019 / ISBN 978–3-946320–13-5 / Preis: 47, 99 €
Seit März 2019 als überarbeitete Neuauflage erhältlich:
Petra Kathke: Sinn und Eigensinn des Materials
Projekte – Impulse – Aktionen
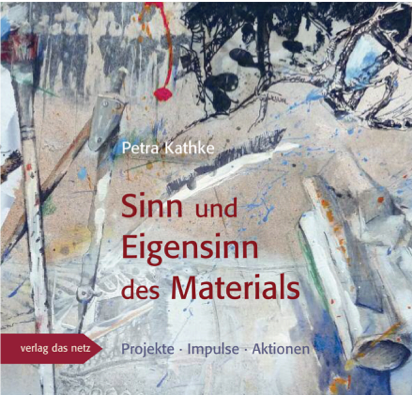
Ausgehend von acht exemplarisch gewählten Materialgruppen wird aufgezeigt, wie die „Materialität des Materials“ junge Menschen über gestalterische Aktivitäten zur sinnstiftenden Auseinandersetzung herausfordern kann. Originelle Zugänge, Informationen zu bildgebenden Verfahren und inspirierende Gestaltungsideen lassen Erlebnisräume einer Kinderkunstwerkstatt lebendig werden, die durch Verweise auf Künstler*innen und Kunstwerke sowie durch theoretische Erläuterungen zur Bedeutung der gestaltgebenden Handhabung des Materials ergänzt werden.
384 Seiten mit zahlreichen Abbildungen / Paperback / verlag das netz, Weimar 2019 / ISBN 978–3-86892–154-0 / Preis: 39, 90
 Blog
Blog
Rezension
„In einer zunehmend globalisierten Welt, die sich dennoch durch die Einteilung in Staaten und verschiedene Kulturkreise unterscheidet, sind unterschiedliche Konstellationen musikalischer Praxen maßgebend, welche gleichbedeutend von der emisch-inneren, als auch der etisch-äußeren Perspektive erlebt und beforscht werden müssen.“
Wallbaum, 2018
Die Rezension des von Christopher Wallbaum herausgegebenen Buches möchte ich mit diesem sinngemäß übersetzten Ausschnitt des Nachwortes beginnen, da er hierin die Legitimation für international-vergleichende Musikpädagogik formuliert. Zugleich trifft er auch den Kerngehalt des vorliegenden Buches, dessen Ausgangspunkt eine Tagung – das Leipzig Symposium 2014– bildet, bei derPraktiken desMusikunterrichts mit Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren in den Pflichtschulsystemen von sieben verschiedenen Ländern verglichen wurden.
 Blog
Blog
Rezension
Das vorliegende Buch verstehe ich als Standortbestimmung im Hinblick auf eine wissenschaftliche Grundlegung von Rhythmik, einem Teilbereich der kulturellen Bildungsarbeit, dem ich mich mit großer Sympathie, allerdings ohne expliziten fachwissenschaftlichen Sachverstand annähere. Mein hauptsächliches Arbeitsgebiet kann man als Allgemeine Kulturpädagogik mit dem Leitbegriff der kulturellen Bildung bezeichnen, wobei meine erziehungswissenschaftliche Heimatdisziplin die historische Bildungsforschung ist. Daher kann ich mich zwar mit großer Neugierde dieser fachwissenschaftlichen Standortbestimmung annähern, aber keine Rezension vorlegen, die dieses Buch in den spezifischen fachwissenschaftlichen Diskurs der Rhythmik kompetent einordnen kann.
 Blog
Blog
Rezension
Vorbemerkung
„Ein Vierjähriger sagt: ‚Ich bin glücklich‘ – ‚Warum bist du glücklich?‘ – ‚Weil ich die Welt spüre.‘“[1]Im (Er)Spüren der Welt scheint ein Schlüssel zu Freude zu liegen. Gespürt wird auch Nicht-Greifbares, was als Stimmung oder Atmosphäre bezeichnet werden kann. Das Nicht-Greifbare zu greifen, um so das Gelingen oder Nicht-Gelingen von Unterricht besser verstehen und ggf. verändern zu können, ist das Anliegen von Julia Jungs Dissertation. In Gernot Böhmes Geleitwort wird der (zumindest für die Schule) allumfassende Ansatz des Forschungsvorhabens deutlich. Pädagogisches Handeln wird demnach immer durch die herrschende Atmosphäre (mit)bestimmt und erzeugt diese zugleich erst, was bereits der Titel der Arbeit „Stimmungen weben“ verdeutlicht.
„‚Stimmungen weben‘ bedeutet, ein feines Gewebe aus Stimmungen herstellen: Stimmungen wahrnehmen, aufgreifen, miteinander verbinden, sich verbinden, miteinbinden, eingewoben sein.“[2]
Erkenntnisinteresse
Jung verknüpft in ihrer Dissertation Atmosphären als ästhetischen Gegenstand mit Unterrichtspraxis, indem sie das Entstehen und Wahrnehmen von Atmosphären näher beleuchtet. Ziel der Überlegungen ist dabei die „Entwicklung eines (fächerübergreifenden) Konzepts für die Lehrerbildung: das ‚Konzept des atmosphärischen Vermögens‘“.[3]Dieses übergeordnete Ziel äußert sich in den Forschungsfragen:
„Was beinhaltet ein atmosphärisches Lehrvermögen im Hinblick auf die Gestaltung einer positiven Unterrichtsatmosphäre? Dem vorangehend muss die Frage danach gestellt werden, welche Unterrichtsatmosphäre als positiv angesehen werden kann.“[4]
 Blog
Blog
Rezension
„Dies ist ein Buch über die Phänomenologie des Literarischen. Um sie zu beschreiben, möchte ich nicht von den Zeichen ausgehen, sondern von dem körperlichen Menschen, der mit ihnen etwas anfangen muss.“ (S. 7) Bereits in dem ersten Satz, mit dem Jan Söffner sein Projekt umreißt, zeigt sich, dass es hier weniger um Musik als um Literatur geht. Mit der Thematisierung des Körpers in seiner Bedeutung für Symbolisierungsprozesse wird, wie sich in der Lektüre offenbart, jedoch ein grundlegender ästhetischer Ansatz entfaltet, der nicht auf eine Kunstform festgelegt ist. So scheint es berechtigt, diesen Ansatz auch im Kontext musikästhetischer Fragestellungen zu thematisieren.
 Blog
Blog
Tagungsbericht zum gleichnamigen Symposium an der Hochschule für Musik
und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ (14.–16.Januar 2016)
Als „Körper-Sprache“ sind Gesten Bestandteil menschlicher Kommunikation, sie können emotionalen Gehalt verstärken und verbale Äußerungen ersetzen, im Alltag sind sie nett oder auch frech, sie symbolisieren Freundschaft, deuten Richtungen an oder demonstrieren Macht. Gesten sind Sinnträger und zugleich verankert im Körper — sie bezeichnen ein Dazwischen, das auch dem Grenzphänomen des Musikalischen eigen ist: Read more »Gesten gestalten – Spielräume zwischen Sichtbarkeit und Hörbarkeit« →
 Blog
Blog
An unsere Kolleginnen und Kollegen, Autorinnen und Autoren sowie alle an der online- Zeitschrift Ästhetische Bildung (zaeb.net) Interessierte jeden Geschlechts,
wir haben uns im Sommer 2016 dazu entschieden, die zaeb.net mit neuen Formen der wissenschaftlichen Kommunikation und Textproduktion zu bereichern. Die bisherige Sammlung aktueller wissenschaftlicher Aufsätze zu einem vorgegebenen thematischen Schwerpunkt, die wir – nun bereits im achten Jahr – ein- bis zweimal jährlich in der zaeb.net veröffentlichen, bleibt bestehen wie bisher, wir ergänzen sie jedoch durch zwei weitere Schwerpunkte, die in einem Blog zusammengefasst werden: Read more »Zum Zaeb-Blog« →